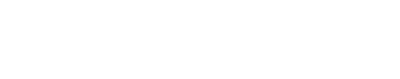"To Err Is Human“, das Standardwerk zur Patientensicherheit, das das Denken und Handeln in Bezug auf Patientenschäden durch medizinische Behandlung grundlegend verändert hat, wird 25 Jahre alt. Es beschreibt die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Umgang mit Fehlern im Gesundheitswesen (Institute of Medicine, 2000). Zudem wird betont, wie wichtig es ist, eine Kultur des offenen Austauschs und des Lernens aus Fehlern zu entwickeln, anstatt Fehler zu vertuschen oder zu bestrafen. Der Bericht diente als Katalysator für Reformen und Bemühungen zur Verbesserung der Patientensicherheit. Er betont auch, dass vermeintliche Fehler oft das Ergebnis vieler Faktoren sind. Eine Beschränkung der Fehlerursache auf den vermeintlichen Verursacher und dessen Sanktionierung würde langfristig nicht zu einer Fehlerreduktion führen, da die mitverursachenden Faktoren nicht beseitigt würden. Daher investieren Gesundheitseinrichtungen in Präventionsstrategien zur Fehlervermeidung und in Schulungsprogramme zur Risikominimierung und Qualitätsverbesserung.
Dennoch ist die Zahl vermeidbarer unerwünschter Ereignisse im deutschen Gesundheitswesen nach wie vor sehr hoch. Laut Weißbuch wird die Zahl der vermeidbaren Todesfälle von Patienten in Deutschland auf 20.000 pro Jahr geschätzt (Schrappe, 2018). Der klassische Ansatz zur Optimierung der Patientensicherheit konzentriert sich bislang auf die Vermeidung inakzeptabler Risiken und die Reduktion inakzeptabler Ergebnisse (Zwischenfälle, Patientenschäden) durch Instrumente des klinischen Risikomanagements. Patientensicherheit wird in diesem Verständnis als Abwesenheit unerwünschter Ereignisse definiert. Eine hohe Sicherheit ist erreicht, wenn wenige oder keine unerwünschten Ereignisse oder Schäden auftreten (Safety-I).
Fehler und Zwischenfälle machen im medizinischen Alltag nur einen geringen Anteil aus, verglichen mit gut bewältigten schwierigen Aufgaben, positiven Verläufen und Überraschungen (siehe Abb. 1). Ein Beispiel aus der Luftfahrtindustrie soll das Lernen aus überwiegend erfolgreichen Verläufen verdeutlichen. Das Management einer Fluggesellschaft weiß, dass harte Landungen zwar selten, aber bei den Kunden unbeliebt sind und diese nach einem solchen Erlebnis möglicherweise die Fluggesellschaft wechseln. Deshalb werden harte Landungen erfasst und versucht, die Ursachen zu identifizieren und – darauf aufbauend – Maßnahmen zu ergreifen, um harte Landungen zu vermeiden. Da aber weiche Landungen das eigentliche Ziel sind, stellt sich die Frage, ob die Analyse harter Landungen genügend Informationen über weiche Landungen liefert. Andererseits bietet die Untersuchung weicher Landungen ein viel größeres Lernfeld. Bezogen auf den Alltag im Gesundheitswesen bedeutet diese Erkenntnis, dass auf das Vorhandensein positiver Ereignisse und erfolgreicher Patientenbehandlungen geachtet wird. Dieser Ansatz liegt Safety-II zugrunde und betont das Lernen aus erfolgreichen Alltagssituationen.
Dieser Perspektivenwechsel wird unausweichlich aufgrund der zunehmenden Komplexität in der Versorgung. Die Einhaltung von Leitlinien und Prozessen ist bei Routinetätigkeiten gut möglich. In der Patientenversorgung wird dies jedoch durch die zunehmende Komplexität deutlich erschwert. Das Gesundheitssystem ist hochkomplex und wird durch eine Vielzahl von Elementen bestimmt, die in zahlreichen, teilweise unvorhersehbaren Wechselwirkungen stehen. Es ist gekennzeichnet durch ein soziotechnisches System, das komplexe organisatorische Abläufe durch interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit als soziales Subsystem umfasst, und ein technisches Subsystem, das moderne technische Geräte, Automatisierung und technisierte Behandlungsmethoden beinhaltet. Die optimale Integration beider Teilsysteme ist entscheidend für die Gesamtleistung. Die Schwere der Erkrankungen der Patientinnen und Patienten (Multimorbidität) sowie die damit einhergehende Mehrfachmedikation (Polypharmazie) erhöhen die Komplexität zusätzlich. In der täglichen Praxis zeigt sich, dass auch außerhalb von Akutsituationen trotz klarer Ablaufvorgaben entscheidende Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Die Gründe hierfür sind vielfältig, zum Beispiel ein Überangebot an unterschiedlichen Leitlinien und komplizierte Handlungsanweisungen. Eine immer weitergehende Standardisierung menschlichen Handelns allein erscheint daher nicht erfolgversprechend. Soziotechnische Systeme wie das Gesundheitswesen müssen lern- und anpassungsfähig sein.
Safety-II als neuer Ansatz zur Stärkung der Patientensicherheit fokussiert auf die überwiegend positiven Behandlungsverläufe und die dafür notwendigen Anpassungen der Beteiligten in der täglichen Praxis sowie die dafür verantwortlichen Faktoren. Safety-II versteht Sicherheit als einen Zustand, in dem möglichst viele positive Ergebnisse erzielt werden. Lernen orientiert sich in diesem neuen Ansatz an der Häufigkeit von Ereignissen und nicht an deren Schwere. Kleine Verbesserungen im Alltag sind oft wichtiger als große Veränderungen bei seltenen Ereignissen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Fähigkeit zu erhalten und zu stärken, sich an Veränderungen und Störungen anzupassen, um die Ziele unter erwarteten und unerwarteten Bedingungen, wie zum Beispiel Notfallsituationen, zu erreichen. Aus Sicht von Safety-II sind Verhaltensanpassungen unter den Bedingungen von Komplexität zu erwarten. Sie sind das Ergebnis einer Abwägung zwischen den Zielen Gründlichkeit und Effizienz. Effizienz spart Zeit, darf aber nicht zu Lasten der Gründlichkeit gehen. Gründlichkeit wiederum ist die Grundlage für Effizienz an anderer Stelle. Effizienz und Gründlichkeit sind komplementär. Im konkreten Fall konkurrieren diese Ziele miteinander, da nie beide Ziele gleichwertig verfolgt werden können.
Ein zentraler Indikator für Komplexität ist die Differenz zwischen Vorstellungen über Versorgungsprozesse (‚work-as-imagined‘, WAI) und der realen Vorgänge (‚work-as-done‘, WAD) (Hollnagel, 2012). Bei der Planung, dem Design, dem Management oder der Analyse von Systemen wird oft stillschweigend davon ausgegangen, dass die Vorgänge im System bekannt und verstanden sind. Diese Überzeugung beruht auf bisherigen Erfahrungen, dem Vergleich mit anderen Systemen und der Beschreibung in Dokumenten wie Layouts, Organigrammen, Stellenbeschreibungen oder Standards. Vorstellungen über das System (WAI) sind vereinfacht und veralten mehr oder weniger schnell. WAD hingegen beschreibt die tatsächlichen Abläufe im System. Obwohl WAI und WAD nie exakt übereinstimmen, spielt dies in einer einfachen, nicht komplexen Arbeitswelt praktisch keine Rolle, da die Abweichungen tolerierbar sind. In komplexen Systemen kann der Unterschied zwischen WAI und WAD jedoch erheblich sein. Ein wesentlicher Grund für den Unterschied liegt in den ständigen Anpassungen der Handlungen an die situativen Gegebenheiten im System. Diese Anpassungen werden ausgelöst durch sich ständig ändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen wie Personalwechsel, technische Ausfälle, Wartezeiten auf Leistungen und Lieferungen oder unerwartetes Patientenverhalten sowie unvollständige und widersprüchliche Informationen.
Eine Funktionale Resonanzanalyse (FRAM) kann die Diskrepanz zwischen WAI und WAD in Prozessen aufdecken und erklären (Hollnagel 2012). Dazu werden Daten über theoretische (das heißt: geplante, dokumentierte, erwartete) Arbeitsabläufe (WAI) und tatsächlich stattfindende Arbeitsabläufe (WAD) gesammelt. Die Datenerhebung kann durch Befragung, Beobachtung, Dokumentenanalyse und Begehung erfolgen. Die Ergebnisse der FRAM können grafisch dargestellt werden. Die Gründe für die festgestellten Unterschiede zwischen WAI und WAD können dann zusammen mit den beteiligten Personen analysiert werden. Auf dieser Basis werden Verbesserungspotenziale identifiziert und Maßnahmen zur Verbesserung der systemischen Resilienz der Prozesse entwickelt, so dass sie robuster gegen Veränderungen und Störungen werden.
Das strategische Ziel des Patientensicherheitsplans der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für den Zeitraum 2021–2030 ist das Konzept hochzuverlässiger Systeme (Bundesministerium für Gesundheit, 2021). Der Leitgedanke dieses Konzepts ist die Resilienz. Diese wird definiert als die Fähigkeit einer Organisation, vor, während oder nach einer Störung einen stabilen und sicheren Zustand aufrechtzuerhalten oder zumindest schnellstmöglich in diesen zurückzukehren. Resiliente Organisationen sind demnach besonders geeignet, die Patientensicherheit in einem komplexen Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Der systemische Ansatz von Safety-II ist eine notwendige Antwort auf die zunehmende Komplexität im Gesundheitswesen. Um effektiv entscheiden und handeln zu können, ist es entscheidend, Komplexität zu verstehen und zu bewältigen. Die Resilienz medizinischer Behandlungsteams ermöglicht es ihnen, Krisen zu bewältigen und die Funktion des sozio-technischen Systems auch bei Störungen und unerwarteten Umständen entschlossen aufrecht zu erhalten. Die Anwendungsmöglichkeiten von Safety-II erstrecken sich dabei über Notfall- und Krisensituationen hinaus auf den gesamten Bereich der Gesundheitsversorgung. Safety-I und Safety-II ergänzen sich und sollten idealerweise zu einer Gesamtlösung kombiniert werden (Hollnagel, 2014).
Fazit
In einer komplexen Welt vertragen sich hohe Anforderungen und Erwartungen an die Versorgung nicht mehr mit überkommenen Lösungsansätzen. Sicherheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit unerwünschter Ereignisse, sondern gerade auch die aktive Fähigkeit, Sicherheit zu erzeugen, insbesondere in unerwarteten kritischen Situationen und unter Druck. Statt immer umfangreicherer Standardisierung und der Jagd nach menschlichen Fehlern müssen wir die Quellen für Resilienz identifizieren und sie in unseren Prozessen stärken. Ein erprobtes Hilfsmittel dafür ist die Funktionale Resonanzanalyse aus dem Methodenrepertoire von Safety-II.
Eine kompakte Einführung und Übersicht zu Safety-II bietet das Buch von Mühlbradt, T., Schröder, S., Speer, T. (2024). Safety-II: Neue Wege zur Patientensicherheit. Strategien, Methoden und praktische Erfahrungen. Wiesbaden: Springer Gabler.
Literatur
[1] Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America (2000). To Err is Human: Building a Safer Health System. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. Washington (DC): National Academies Press.
[2] Schrappe, M. (2018). APS-Weißbuch Patientensicherheit. Sicherheit in der Gesundheitsversorgung: neu denken, gezielt verbessern. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, S. 309–315.
[3] Hollnagel, E. (2012). FRAM: the Functional Resonance Analysis Method. Farnham, Surrey: Ashgate.
[4] Bundesministerium für Gesundheit (2021). Globaler Aktionsplan für Patientensicherheit 2021–2030. Auf dem Weg zur Beseitigung vermeidbarer Schäden in der Gesundheitsversorgung (Deutsche Übersetzung). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/P/Patientensicherheit/WHO_Global_Patient_Safety_Action_Plan_2021-2030_DE.pdf (abgerufen am 13.07.2024).
[5] Hollnagel, E. (2014). Safety-I and Safety-II. The Past and Future of Safety Management. Boca Raton: CRC Press.
Über den Autor:
Prof. Dr. med. Stefan Schröder, MHBA
Chefarzt
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie
Krankenhaus Düren gem. GmbH
Roonstraße 30
52351 Düren
Kontakt
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von www.bdc.de
Artikel als Download inkl. Grafik HIER!